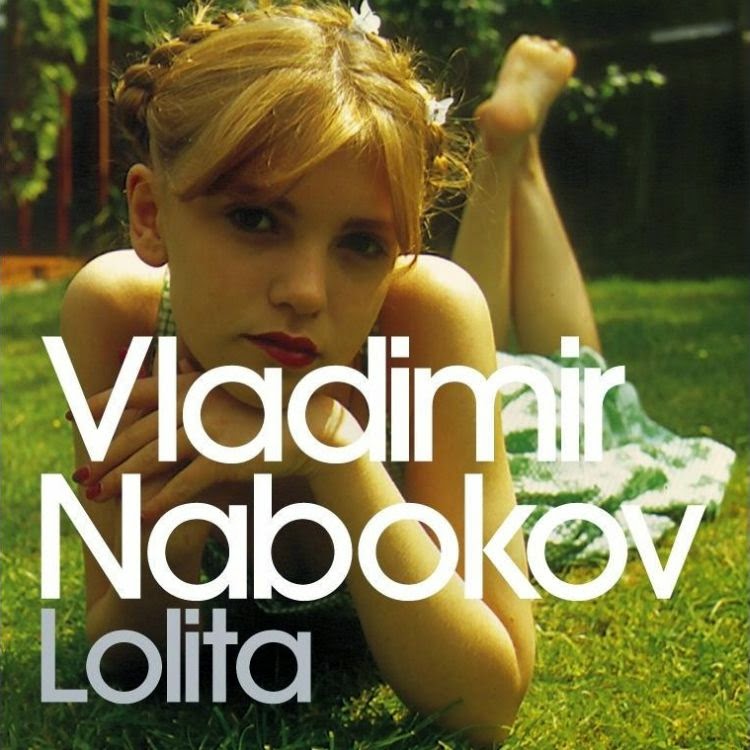Drei bekannte Autoren derselben Epoche, aber nicht derselben literarischen Epoche. Drei bekannte Erzählungen. Drei ganz unterschiedliche Formen literarischen Erzählens.
Gesucht werden
I. Eigenarten des Erzählens, der jeweiligen Darstellung der literarischen Welt.
III. Unterschiede und Parallelen
III: Sprachliche Möglichkeiten, diese zu benennen und zu beschreiben.
- Der erste Satz: Ein kalter oder ein heißer Beginn? Was wird erzählt?
- Irritationsgrad und -ursachen? Wie zugänglich wird vermittelt?
- Was erfahren wir über die Hauptfigur?
- Eigenart der jeweiligen Sprache: Klarheit, Syntax, Wortwahl, Schwierigkeitsgrad?
- Atmosphäre und Wirkung
Ich beginne meine Geschichte mit einem Erlebnisse der Zeit, wo ich etwa zehn bis elf Jahre alt war und in die Lateinschule unseres Städtchens ging.
Viel duftet mir da entgegen und rührt mich von innen mit Weh und mit wohligen Schauern an, dunkle Gassen und helle, Häuser und Türme, Uhrschläge und Menschengesichter, Stuben voll Wohnlichkeit und warmem Behagen, Stuben voll Geheimnis und tiefer Gespensterfurcht. Es riecht nach warmer Enge, nach Kaninchen und Dienstmägden, nach Hausmitteln und getrocknetem Obst. Zwei Welten liefen dort durcheinander, von zwei Polen her kamen Tag und Nacht.
Die eine Welt war das Vaterhaus, aber sie war sogar noch enger, sie umfaßte eigentlich nur meine Eltern. Diese Welt war mir großenteils wohlbekannt, sie hieß Mutter und Vater, sie hieß Liebe und Strenge, Vorbild und Schule. Zu dieser Welt gehörte milder Glanz, Klarheit und Sauberkeit, hier waren sanfte freundliche Reden, gewaschene Hände, reine Kleider, gute Sitten daheim. Hier wurde der Morgenchoral gesungen, hier wurde Weihnacht gefeiert. In dieser Welt gab es gerade Linien und Wege, die in die Zukunft führten, es gab Pflicht und Schuld, schlechtes Gewissen und Beichte, Verzeihung und gute Vorsätze, Liebe und Verehrung, Bibelwort und Weisheit. Zu dieser Welt mußte unsre Zukunft gehören, so mußte sie klar und reinlich, schön und geordnet sein.
Das erste Kapitel in Hermann Hesses ›Demian‹ (1919)
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen.
»Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den vier wohlbekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem eine auseinandergepackte Musterkollektion von Tuchwaren ausgebreitet war – Samsa war Reisender – hing das Bild, das er vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hatte. Es stellte eine Dame dar, die mit einem Pelzhut und einer Pelzboa versehen, aufrecht dasaß und einen schweren Pelzmuff, in dem ihr ganzer Unterarm verschwunden war, dem Beschauer entgegenhob.
Gregors Blick richtete sich dann zum Fenster, und das trübe Wetter – man hörte Regentropfen auf das Fensterblech aufschlagen – machte ihn ganz melancholisch. »Wie wäre es, wenn ich noch ein wenig weiterschliefe und alle Narrheiten vergäße«, dachte er, aber das war gänzlich undurchführbar, denn er war gewöhnt, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in diese Lage bringen.
Beschreibung einer weiteren Figur
An einem freien Nachmittag — ich war wenig mehr als zehn Jahre alt — trieb ich mich mit zwei Knaben aus der Nachbarschaft herum. Da kam ein größerer dazu, ein kräftiger und roher Junge von etwa dreizehn Jahren, ein Volksschüler, der Sohn eines Schneiders. Sein Vater war ein Trinker und die ganze Familie stand in schlechtem Ruf. Franz Kromer war mir wohl bekannt, ich hatte Furcht vor ihm, und es gefiel mir nicht, als er jetzt zu uns stieß. Er hatte schon männliche Manieren und ahmte den Gang und die Redensarten der jungen Fabrikburschen nach. Unter seiner Anführung stiegen wir neben der Brücke ans Ufer hinab und verbargen uns vor der Welt unterm ersten Brückenbogen. Das schmale Ufer zwischen der gewölbten Brückenwand und dem träg fließenden Wasser bestand aus lauter Abfällen, aus Scherben und Gerümpel, wirren Bündeln von verrostetem Eisendraht und anderem Kehricht. Man fand dort zuweilen brauchbare Sachen; wir mußten unter Franz Kromers Führung die Strecke absuchen und ihm zeigen, was wir fanden. Dann steckte er es entweder zu sich oder warf es ins Wasser hinaus. Er hieß uns darauf achten, ob Sachen aus Blei, Messing oder Zinn darunter wären, die steckte er alle zu sich, auch einen alten Kamm aus Horn. Ich fühlte mich in seiner Gesellschaft sehr beklommen, nicht weil ich wußte, daß mein Vater mir diesen Umgang verbieten würde, wenn er davon wüßte, sondern aus Angst vor Franz selber. Ich war froh, daß er mich nahm und behandelte wie die andern. Er befahl, und wir gehorchten, es war, als sei das ein alter Brauch, obwohl ich das erstemal mit ihm zusammen war.
Schließlich setzten wir uns an den Boden. Franz spuckte ins Wasser und sah aus wie ein Mann; er spuckte durch eine Zahnlücke und traf, wohin er wollte. Es begann ein Gespräch, und die Knaben kamen ins Rühmen und Großtun mit allerlei Schülerheldentaten und bösen Streichen. Ich schwieg und fürchtete doch, gerade durch mein Schweigen aufzufallen und den Zorn des Kromer auf mich zu lenken. Meine beiden Kameraden waren von Anfang an von mir abgerückt und hatten sich zu ihm bekannt, ich war ein Fremdling unter ihnen und fühlte, daß meine Kleidung und Art für sie herausfordernd sei. Als Lateinschüler und Herrensöhnchen konnte Franz mich unmöglich lieben, und die beiden andern, das fühlte ich wohl, würden mich, sobald es darauf ankäme, verleugnen und im Stich lassen.
Aber der Prokurist hatte sich schon bei den ersten Worten Gregors abgewendet, und nur über die zuckende Schulter hinweg sah er mit aufgeworfenen Lippen nach Gregor zurück. Und während Gregors Rede stand er keinen Augenblick still, sondern verzog sich, ohne Gregor aus den Augen zu lassen, gegen die Tür, aber ganz allmählich, als bestehe ein geheimes Verbot, das Zimmer zu verlassen. Schon war er im Vorzimmer, und nach der plötzlichen Bewegung, mit der er zum letztenmal den Fuß aus dem Wohnzimmer zog, hätte man glauben können, er habe sich soeben die Sohle verbrannt. Im Vorzimmer aber streckte er die rechte Hand weit von sich zur Treppe hin, als warte dort auf ihn eine geradezu überirdische Erlösung.







.jpg)